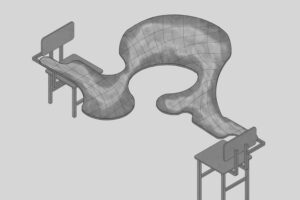„Hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein“, lautet der allgegenwärtige Werbeslogan des Drogeriemarktes dm. Basierend auf Goethes zentralem Freiheitsgedanken in Faust („Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein“) wurde somit das Sein durch das Konsumieren ersetzt. Identifizieren wir uns also tatsächlich mehr durch das Haben als durch das Sein? Oder basiert unser Sein letztlich nur auf dem Haben?
Der Philosoph Erich Fromm bietet eine Möglichkeit, die Beziehung zwischen dem Haben und Sein zu erklären. Nach Fromm ist der moderne Konsument dadurch gekennzeichnet, dass er ist, was er hat und was er konsumiert (Fromm 1976: 36). Konsum sei eine Form des Habens, des Besitzes. Konsumieren kann – nach Fromm – zweideutig aufgefasst werden: Das bereits Konsumierte kann nicht wieder entzogen werden. Es ist ein abgeschlossener Akt. Dennoch ist dieser Akt Teil eines Prozesses, denn es hinterlässt ein Bedürfnis nach mehr. Die Befriedigung durch den Konsum ist lediglich temporär und muss, um aufrechterhalten zu werden, wiederholt werden. Fromms Aussage „Ich (Subjekt) habe O (Objekt)“ (ebd.: 80) drückt die Definition des Seins durch den Besitz aus. Demnach bin nicht ich selbst das Subjekt, sondern ich bin, was ich habe (vgl. ebd.). Die Dinge, die wir besitzen, mit denen wir arbeiten und leben, beeinflussen das Sein und unsere Identität – aber wie sieht die Beziehung zu diesen Dingen aus?
Früher wurde alles, was man besaß, gepflegt; der Besitz wurde solange benutzt, wie es nur irgendwie möglich war – heute besitzen die Großeltern häufig noch Gegenstände von ihren Eltern, die sie wiederum von ihren Eltern erhielten. Ausgehend von der Annahme, dass wir unsere Socken, Computer oder Autos jahrelang benutzen bzw. behalten – bis sie irgendwann kaputt gehen – erscheint es naheliegend, dass sie ein Teil von uns werden, denn wir haben sie individualisiert und verinnerlicht (vgl. Rosa 2013: 125). Aber die einst vorherrschende Bindung an den Besitz (kaufen, um zu behalten) ist heute kaum noch festzustellen. Bereits in den Jahrzehnten nach dem Ersten Weltkrieg veränderte sich die Einstellung zu dem eigenen Besitz und es entwickelten sich zunehmend auf den Verbrauch ausgerichtete Konsummuster (kaufen, um wegzuwerfen). (vgl. Fromm: 75) Die Art der Beziehung zu den Dingen hat sich einhergehend mit der erhöhten Geschwindigkeit ihrer Austauschraten verändert (vgl. Rosa 2013: 125). Zahlreiche Produkte sind heute darauf ausgelegt, sie nicht lange verwenden zu können, denn „neu ist besser“, wie es beispielsweise der Konsum von Smartphones verdeutlicht. Bevor wir eine Beziehung zu der neuen Kleidung, zu dem geleasten Auto oder dem neuen Smartphone aufbauen können, trennen wir uns wieder von ihnen. Auf diese Art können diese Dinge jedoch keinesfalls ein Teil von uns werden und sie bleiben uns fremd (vgl. ebd.: 126).
[su_pullquote align=“right“ class=“konsum rot“]Es gehört sich nicht, viel mehr zu besitzen, als man eigentlich braucht.[/su_pullquote]
Festzustellen ist weiterhin ein Wandel des Konsums im 21. Jahrhundert – soziale Konsummuster wie Sharing und Prosuming scheinen zunehmend dem kapitalistisch orientierten Besitzdenken entgegenzuwirken und ein „postmoderner Konsument“ scheint sich hervorzuheben: Ich bin, was ich nicht habe und nicht konsumiere. Entgegengesetzt der Logik der Wachstumsgesellschaft geht es heute immer häufiger darum, Dinge nicht zu besitzen, sie zu teilen oder wegzugeben. Streaminganbieter wie Spotify, Amazon Prime oder Netflix ermöglichen den zeitweisen Zugang zu von anderen geschaffenen Medien, ohne dass diese in den eigenen Besitz übergehen (wie einst die klassische DVD oder CD). Wohnungen werden lieber gemietet, als gekauft – obwohl dies langfristig nicht zwangsläufig günstiger ist. Spätestens seit Beginn des übergreifenden Diskurses über Ressourcenverknappung, Klimawandel sowie Umweltverschmutzung, hat der Besitzende ein Problem mit seinem Image: Es gehört sich nicht, viel mehr zu besitzen, als man eigentlich braucht – zu viel Besitz geht zunehmend mit dem Vorwurf von Verantwortungslosigkeit einher (vgl. Oberhuber 2016). Beispielhaft hierfür sind Bill Gates‘ und Mark Zuckerbergs großzügige Spenden in Milliardenhöhe. Wären diese nicht in der Öffentlichkeit kommuniziert worden, hätte es sich tatsächlich um altruistische Gesten gehandelt – aber die Handlung des Weggebens erhöht das Image und wertet das Sein auf. Dennoch geht es neben den eher eigennützigen Antrieben auch zunehmend um das ökologische Gewissen: In der Wahrnehmung vieler Konsumenten impliziert Teilen („Sharing“) die Vorstellung eines nachhaltigen Konsums und eines umweltverträglichen Verbrauchs von Ressourcen („Sharing is caring“) (vgl. Leitherer 2018). Sharing wird gleichzeitig als ein Schritt Richtung einer „Glücksökonomie“ gesehen: Geld und Besitz führen nur begrenzt zu einer Steigerung des Wohlbefindens, Teilen und Kooperation machen deutlich glücklicher als das Streben nach Status (vgl. Bala/ Schuldzinski 2016: 7ff.).

Dass Reichtum allein das seelische Wohlbefinden und Glücksempfinden nicht ausmacht, ist mittlerweile basierend auf jahrelanger Glücksforschung bekannt – entgegengesetzt der Fokussierung auf das Wirtschaftswachstum einer Nation, gemessen durch die Wachstumsrate des realen Bruttoinlandsprodukts. Reiche Nationen werden nicht zwangsläufig glücklicher, wenn sie noch reicher werden. Es setzt ein Gewöhnungseffekt ein, der die Befriedigung von materiellen Gütern schnell vergehen lässt (vgl. Ruckriegel 2007: 3). Das sogenannte Easterlin-Paradoxon beschreibt den Zusammenhang zwischen Einkommen und Glück: Basierend auf den Forschungen des Ökonomen Richard Easterlin (1974) wurde festgestellt, dass trotz eines Anstiegs des Lebensstandards durch den Wirtschaftsboom nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere in den USA, die Bürger nicht glücklicher wurden. Easterlins Erkenntnis ist ein entscheidendes Problem für die gängige Mikroökonomie, denn hier ist „mehr ist besser als weniger“ eines der grundlegenden Prinzipien der Konsumententheorie (vgl. Ruckriegel 2007: 5; Easterlin 1974: 89ff.). Gewöhnung und Vergleich werden jedoch nicht berücksichtigt – dabei sind gerade diese Faktoren die Ursachen für das Paradoxon. Ausgehend davon, dass die materielle Existenz gesichert ist, ist weniger das tatsächliche Einkommen, sondern vielmehr das relative Einkommen von Bedeutung: Geld per se kann durchaus glücklich machen, aber nur dann, wenn der Einzelne mehr davon hat, als der Andere. Würden alle Menschen gleichzeitig wohlhabender werden, bliebe auch die Lebenszufriedenheit gleich (vgl. Easterlin 1974: 118ff.). Ebenso passt sich das Individuum an die materiellen Güter an, sodass sich mit steigendem Einkommen auch die Ansprüche erhöhen – wodurch letztlich keine größere Zufriedenheit erwachsen kann (vgl. ebd.). Einkommenssteigerungen, die das Wohlergehen der Bevölkerung durch eine Erhöhung der Konsummöglichkeiten erhöhen sollen, können demnach kaum eine nachhaltige Wirkung haben, da der Konsum materieller Güter nur geringe Auswirkungen auf das Wohlbefinden oberhalb eines bestimmten Verbrauchsniveaus hat – hier spricht man auch von einer „hedonistischen Tretmühle“ (Ruckriegel 2007: 7). Vielmehr gehen Glück und Zufriedenheit mit Erfahrungen und Erlebnissen einher, insbesondere mit anderen Menschen (vgl. Kahnemann et al. 2006: 2f.).
Unabhängig davon, ob wir uns durch Besitz oder Nicht-Besitz definieren, scheinen die Befriedigung und das damit einhergehende Glücksgefühl ständig abzunehmen. Der Soziologe Hartmut Rosa äußerte sich in einem Interview mit der ZEIT dazu: „Je mehr ich mir kaufen kann, umso kürzer hält die Befriedigung“ (Radisch 2007) – und wir kaufen immer mehr. Häufig geht es dabei jedoch nur um die Steigerung von Optionen – wir geben immer mehr Geld für Dinge aus, die wir theoretisch nutzen könnten, der tatsächliche Verbrauch ist jedoch gering. Wie viele der Millionen Titel des Streaminganbieters Spotify werden wirklich gehört? Wie viele der heruntergeladenen E-Books werden gelesen? Insbesondere Flatrates suggerieren einen nahezu unbegrenzten Verbrauch, ob Internet, Telefonie oder Strom, alles kann jederzeit abgerufen werden – dabei vergessen wir jedoch häufig den Preis, den wir regelmäßig zahlen und damit auch die Tatsache, dass wir rund um die Uhr konsumieren. Wir wollen nichts wirklich besitzen, aber auch auf nichts verzichten. Letztlich „wissen [wir] nicht mehr, was wir alles haben, […], die Waren bleiben uns fremd. Wir eignen sie uns nicht an“. (Radisch 2007) Um Glück und Zufriedenheit erfahren zu können, müssen wir uns die Dinge, die wir konsumieren, wieder aneignen, sie müssen ein Teil von uns werden, sie müssen erlebt werden.
[su_divider top=“no“ divider_color=“#DC826F“ margin=“35″]
Literatur
Bala, C./ Schuldzinski, W. (2016): Neuer sozialer Konsum? Sharing Economy und Peer-Produktion. In: Prosuming und Sharing – neuer sozialer Konsum. Aspekte kollaborativer Formen von Konsumtion und Produktion. Verbraucherzentrale NRW. Düsseldorf.
Easterlin, R. A. (1974): Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence. In: Nations and Households in Economic Growth. New York: Academic Press. S. 89–125.
Fromm, E. (1976): Haben oder Sein. Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft. München: dtv. 1979.
Kahnemann, D. et al. (2006): Would you be happier if you were richer? A focusing illusion. CEPS Working Paper No. 125.
Leitherer, J. (2018): Sharing definiert Konsum neu. In: Springer Professional. Online verfügbar unter: https://www.springerprofessional.de/konsumguetermarketing/nachhaltigkeit/sharing-definiert-konsum-neu/15429810 [Zugriff: 04.05.2018].
Oberhuber, N. (2016): Unser absurder Konsum. In: ZEIT Online. Online verfügbar unter: https://www.zeit.de/wirtschaft/2016-07/zufriedenheit-konsum-sharing-hartmut-rosa [Zugriff: 04.05.2018].
Radisch, I. (2007): „Wir wissen nicht mehr, was wir alles haben.“ In: Die Zeit, 19.12.2007, Nr. 52. Online verfügbar unter: https://www.zeit.de/2007/52/Interview-Rosa [Zugriff: 04.05.2018].
Rosa, H. (2013): Beschleunigung und Entfremdung. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.
Ruckriegel, K. (2007): Happiness Research (Glücksforschung) – eine Abkehr vom Materialismus. Nürnberg.