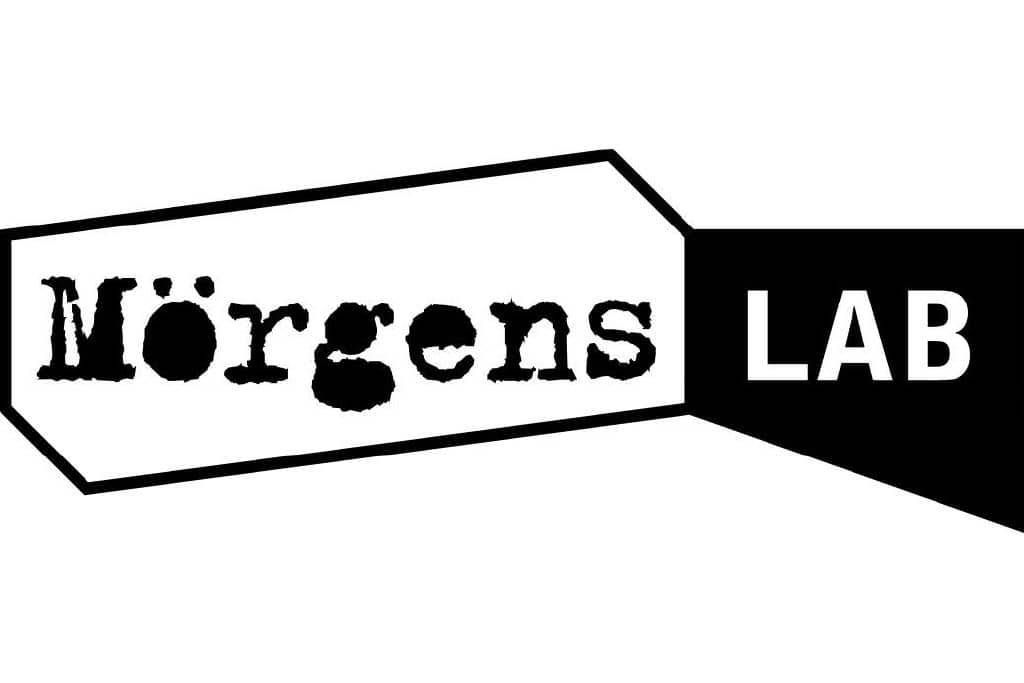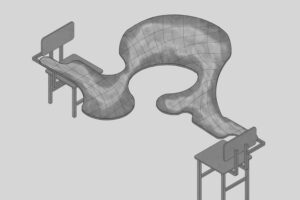Das MörgensLab ist ein Theater-Labor des Stadttheater Aachen, das als Schnittstelle zwischen Kunst und Wissenschaft fungieren soll. In Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen, der FH-Aachen und weiteren Aachener Hochschulen bringt das MörgensLab aktuelle, in der Forschung relevante Themen auf die Bühne und versucht, dem Publikum komplexe, wissenschaftliche Zusammenhänge durch Schauspiel zugänglich zu machen.
MörgensLab
Die philou. hat mit Ulrike Günther vom Projekt MörgensLab des Theater Aachen über das Thema Chaos am Theater gesprochen. Ulrike ist Leiterin des Projektes und freischaffende Regisseurin. Sie arbeitet an Stückentwicklungen, das heißt an der Entstehung eines neuen Theaterstückes von der Idee hin bis zur Aufführung. „Ad Memoriam“ ist eines ihrer aktuellen Stücke, das im Rahmen des MörgensLab-Kooperationsprojektes entstanden ist.
philou. Wie ist die Idee zu dem aktuellen Theaterstück „Ad Memoriam“ entstanden und worum geht es in dem Stück?
Wenn ich mir so ein Thema aussuche, startet es immer aus einem persönlichen Interesse heraus. Oft ist es so, dass ich ein Projekt mache und dann innerhalb der Recherchearbeit ein nächstes interessantes Thema auftaucht. „Ad Memoriam“ ist ein Monolog, ein Ein-Frau Stück, in dem es um Erinnerungen geht. Ein Ausgangspunkt für die Idee des Stücks war es, zu schauen, wie wahr eine Erinnerung ist. Wir denken von Erinnerungen immer, dass sie etwas sind, worauf wir uns verlassen können. Aber sind sie nicht vielleicht nur eine Schicht oder eine mögliche Version von etwas? Es geht darum, dass Erinnerungen immer wahr sind, aber trotzdem immer gelogen. Es ist immer beides. Es ist wahr für die Person, die sich erinnert. Das heißt zum Beispiel: wenn ich mich an etwas erinnere, kann meine Familie sich anders daran erinnern. Dann ist das für mich kein bewusster Vorgang, dass ich da irgendetwas verändere, sondern für mich stimmt die Erinnerung. Aber das heißt nicht, dass sie nicht auch unwahr sein kann. Und das ist dann auch interessant für ein Theaterstück.
p. Welche wissenschaftlichen Grundlagen wurden für das Stück verwendet?
Die hauptsächlichen Informationsquellen waren wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Neurologie und Psychologie. Zum einen die Neurologie, um abzugleichen, was der physische Vorgang ist, was wirklich passiert. Zum anderen die Psychologie, dort geht es mehr darum, wie wir das bewerten. Also, wie kann man das psychologisch verstehen, was da passiert? Hier gab es dann unterschiedliche Quellen: Interviewpartner*innen, aber auch wissenschaftliche Artikel, die wir nach dem Lesen noch mal mit den Kolleg*innen aus der Forschung abgeglichen haben.
p. Inwiefern passt das Thema Chaos zum Inhalt des Stücks?
Was für mich zu dem Thema Chaos gut passt, ist die Funktion des Gedächtnisses: Wir arbeiten immer wieder mit dem Bild einer sehr chaotischen Bibliothek, in der nichts verloren geht. Das heißt, wenn ich etwas vergesse, ist es nicht unbedingt weg. Es ist eigentlich nie weg. Ich finde es nur nicht.
p. Worin liegt die Schwierigkeit, ein komplexes wissenschaftliches Thema durch Schauspiel darzustellen?
Wenn ich so eine Stückentwicklung mache, noch dazu mit einem wissenschaftlichen Thema, dann habe ich erst mal Material, was nicht theatral ist. Das heißt, es gibt noch keine Figuren, es gibt noch keine Geschichte, es gibt erst mal nur Daten, es gibt erst mal Information. Und dann ist die große Aufgabe, daraus eine Geschichte zu machen oder Figuren entstehen zu lassen, eine Erzählform zu finden. Was ich bei Stückentwicklungen wichtig finde, ist: Man sammelt wissenschaftliches Material zum Thema und dann muss man irgendwann das Ganze auch zusammenziehen, indem man einen Fokus setzt, das heißt aber auch, dass man eine Auswahl treffen muss.
p. Chaos kann als Zustand vollständiger Unordnung, als Wirrwarr beschrieben werden oder als Unvorhersagbarkeit von Prozessen. Wie verläuft der Prozess der Inszenierung, wie verlaufen die Proben? Kann man hier von einem kreativen Chaos sprechen?
Mein Schreibtisch ist tatsächlich nicht aufgeräumt, aber ich würde das nicht als kreatives Chaos bezeichnen. Wenn ich arbeite, ist das gar kein Chaos im Sinne von „es geht alles durcheinander“, sondern es ist mehr so, dass man an einem Punkt startet und ab dann öffnen sich – mit dem Rechercheprozess – immer mehr Türen. Und daraus entstehen Ideen. Aber das ist kein chaotischer Prozess, sondern ein assoziativer. Ich würde das als Assoziationsketten bezeichnen. Ebenso kann ich mir nicht theoretisch ausdenken, was zum Schluss als Form funktioniert. Der Probenprozess und die enge Zusammenarbeit mit den Schauspieler*innen haben auch immer einen Einfluss auf die Form und den Inhalt des Stücks. Man muss sich die Freiheit behalten, darauf einzugehen, was gerade passiert. Das ist, glaube ich, das Wichtigste in so einem Probenprozess. Denn wenn ich nur meine Linie durchziehe, dann entsteht auch nichts. Damit Kunst entstehen kann, muss auch ganz viel Freiheit da sein. Und das kann man nicht kontrollieren. Genauso wie man Ideen nicht kontrollieren kann und wie man Assoziationen nicht kontrollieren kann. Und es entstehen natürlich auch Ideen aus, ich sage jetzt mal Unfällen oder Dingen, die vielleicht nicht so geplant waren. Wir arbeiten ja auch mit Improvisationen in den Proben. Das heißt, man setzt sozusagen für die Schauspieler*innen einen Rahmen und darin probieren sie sich aus. Ich würde immer sagen, dass die Ideen, die die Schauspieler*innen auf der Bühne haben, besser sind als das, was ich mir am Schreibtisch ausdenken kann. Zum Schluss ist es meine Aufgabe, das Ganze so zu sortieren, dass es im Stück funktioniert.
p. Wir als Zuschauende stellen uns das so vor, dass es vor und hinter der Bühne manchmal ziemlich chaotisch zugehen kann. Ist das so? Und wenn ja, welche Auswirkungen hat das?
Also, wenn man eine große Oper aufführt, an der 80 Leute beteiligt sind, dann sind das auch viele Leute hinter der Bühne und das darf nicht chaotisch sein. Denn sonst funktioniert es auf der Bühne nicht. Das heißt, es ist immer geordnet, wer wann in die Maske muss, wer wann ein Kostüm wechselt, welcher Scheinwerfer wann verändert wird, wann die Toneinsätze sind, damit es nach außen alles locker-flockig improvisiert aussieht. Aber es ist schon alles getimt und geordnet.
Wenn jetzt aber bei einer Vorstellung jemand zum Beispiel den Text vergisst, oder wenn ein Scheinwerfer ausfällt oder ähnliches, dann sind das alles Situationen, die bei uns Theaterschaffenden für Stress sorgen. Lustigerweise bekommt das Publikum das in den seltensten Fällen mit, weil es nicht weiß, wie es gedacht war. Die Schauspieler*innen fühlen sich ja auch nicht immer gleich auf der Bühne. Es gibt also immer auch eine menschliche Komponente, die man überhaupt nicht kontrollieren kann. Und das ist nicht nur auf der Bühne so, sondern auch im Zuschauerraum. Auch dort kann etwas passieren, das völlig unvorhergesehen ist. Ich kann nicht die Reaktion des Publikums planen. Vielleicht steht jemand plötzlich auf, geht raus und schmeißt die Türen, weil er das Stück ganz furchtbar findet. Oder jemand lacht an einer Stelle, an der eigentlich noch nie irgendjemand gelacht hat. Es gibt so viele Faktoren, die so eine Aufführung beeinflussen. Da wären wir dann bei der Chaostheorie. Man kann den Output nicht exakt planen, weil es zu viele Faktoren gibt. Und darum ist so eine Aufführung immer anders. Es passiert immer noch irgendetwas, das nicht so geplant war. Und das macht das Theater lebendig.
Das Interview wurde geführt von Jil Hoffmann, Sumin Kim und Yvonne Schneider
Weitere Informationen über das MörgensLab und Ulrike Günther finden sich unter: https://www.theateraachen.de/de_DE/moergenslab?p=1 „Ad Memoriam“ ist auch in der Spielzeit 2022/23 wieder im Mörgens zu sehen.