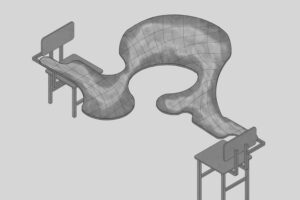Scientia est potenta ‑ Wissen ist Macht. Der beliebte Aphorismus des englischen Philosophen Francis Bacon bildet eine Redensart, die in der Neueren Geschichte eine historisch bislang konventionelle Nutzung erfahren hat. So suggeriert der Ausdruck, dass Erkenntnis die Verfügbarkeit und damit Anwendung von Einfluss ermöglicht: Gesellschaftliches Wissen und Machtverhältnisse bedingen sich demnach gegenseitig.
Getragen wird dieses Verhältnis durch den fortschreitenden rationalistischen Erkenntnisgewinn der Wissenschaft: Ein reflexiver Betrachtungsansatz der Wissensgeschichte und des eigenen Wissens im Kontext von Macht.
Erkenntnis als Ordnung
Bacons ursprüngliche Aussage bietet eine Grundlage für diese Hinterfragung: Nam et ipsa scientia potestas est – Das Wissen [oder: die Wissenschaft] an sich ist Macht (vgl. Bacon 1825: 219). Die lateinische Formulierung offenbart eine definitorische Gleichsetzung von Wissen und Wissenschaft. Sie leitet zur allgemeingültig anerkannten Wissensproduktion durch die Wissenschaft über. In ihrem Selbstverständnis ist die wissenschaftliche Methodik ‑ basierend auf Faktizität und Erkenntnis ‑ ein kausales System und eine der tragenden gesellschaftlichen Ordnungsstrukturen. Das abgeleitete Wissen wird darin gesammelt, tradiert und baut aufeinander auf. Die Wissenschaft ist also per se auch immer eine Wissensgeschichte.
Die vorliegende kritische Betrachtungsweise soll vor allem die Geschichtlichkeit von Erkenntnis – also der Geistesgeschichte – thematisieren. So gibt es eine Denkströmung, die sich seit der Aufklärung als gesellschaftlicher „Commonsense“ (Spinner 1977: 33) etabliert hat: Der Rationalismus. Durch seine „erkenntnistheoretisch[e] Eigenart [und] ideengeschichtlich[e]Bedeutung“ (ebd.) ist er tief mit der Wissensgeschichte verbunden.
Somit ist der Rationalismus denktheoretischer Baustein der staatstragenden Ordnung. Doch was bedeutet das für unser Geschichts- und Wissensverständnis? Und welchen Einfluss hat er auf gesellschaftliche Machtverhältnisse?
Dogma der Ratio ‑ Ein Kontinuum?
Der Siegeszug des Rationalismus ist verwoben mit der Tradition der Aufklärung (vgl. Grössing/ Mühlenberger 2012: 48ff.). Frei nach dem Prinzip: Verum quia factum – das Wahre ist das Geschaffene (vgl. Spinner 1977: 8), bauen geisteswissenschaftliche Urteile und Aussagen auf nicht-empirischen Erkenntnisprozessen auf. Der Philosoph und Wissenstheoretiker Helmut Spinner bezeichnet diese Herangehensweise als eine „im Zwielicht von Erkenntnis und Entscheidung“ (ebd.: 34) getroffenen Annahme. „Wahrheit“ ist nicht einfach gegeben, sie ist bis zu einem gewissen Grad auch immer Entscheidung und Bewertung. Dieses normativ philosophische Postulat bildet die Grundlage eines prägenden Verständnisses von Geistesgeschichte: Annahme aufbauend auf Annahme. Wissen und Vernunft erheben danach Anspruch auf Neutralität und Naturgegebenheit, sind aber tatsächlich immer sukzessiv aus ihrem zeitgeschichtlichen Kontext geboren und von Werturteilen beeinflusst.
Diskontinuität vs. Kontinuität
Doch verliert die Geistes- und Wissensgeschichte nicht eine Dimension ihrer reflexiven Kritikfähigkeit, wenn sie einem linearen Prozess folgen sollte? Insbesondere postmoderne Philosophen des 20. Jahrhunderts wie Gaston Bachelard und Michel Foucault kritisierten dieses Verständnis von kontinuierlicher Geschichte. Bachelard formuliert, dass es „Brüche“ – also enorme Veränderungen – innerhalb der Wissensgeschichte gebe, die nicht einfach ex nihilo erscheinen würden. Beide Philosophen vertreten die Auffassung: Wissenschaft beobachtet nicht nur, sie konstruiert auch (vgl. Rouff 2009: 85). Diese Brüche oder „Diskontinuitäten“, wie Foucault sie bezeichnet, sind eine Schnittstelle machttheoretischer Analysen.
„Die zwei Grundbegriffe der Geschichte, so wie man sie heute schreibt, sind nicht länger die Zeit und die Vergangenheit, sondern die Veränderung und das Ereignis.“
Foucault 2001: 337
Durch fundamentale Änderungen verschiedener Wissensformen, wie der Biologie, politischer Ökonomie, Psychiatrie und Medizin, hat sich auch die damit verbundene wissenschaftliche Sprache verändert. Die Entwicklungsgeschichte dieser Disziplinen hat im 19. und 20. Jahrhundert unvorhersehbare Entwicklungsschübe durchlaufen (vgl. Rouff 2009: 88ff.). Hierbei geht es aber nicht nur um die Beschreibung von „inhaltlichen Korrekturen, Brüchen oder Paradigmenwechseln“ (Foucault 2003: 190), sondern um den Wandel der Bedeutung von Sprachkategorien. Diese fasst Foucault als Diskurse zusammen. Anhand seiner methodischen Diskursanalyse ‑ einer „Beschreibungsmethode“ (Sarasin 2016: 98) – versucht er, die historische Perspektive und damit auch die Genealogie von Machtverhältnissen zu ergründen (vgl. ebd.: 100f.).
Diskursanalyse: Ein deskriptiver Ansatz
In seinem Werk Die Ordnung der Dinge (1974) elaboriert Foucault diese Methodik, mit der er das Verhältnis von Wissen und Macht als gesamtgesellschaftliches Ordnungssystem ergründet. Die Analyse abstrahiert im Wesentlichen die Konstruktion und „gesellschaftlich[e] Unterhaltung von komplexen Wissenssystemen“ (Ruoff 2009: 92). Anhand des sprachlichen Wandels können die formbaren „Wahrheiten, die sich innerhalb von Denksystemen in der Geschichte formieren“ (ebd.), deskriptiv herangezogen werden. Der Signifikant ist hierbei aber nicht die Sprache, sondern es sind die Wörter oder „Zeichen“ (Sarasin 2016: 102). Sie transportieren neben ihrer sprachlichen Bedeutung vor allem eine inhaltliche Gliederung für die Gesellschaft.
So fasst der Wissenschaftshistoriker Hans-Jörg Rheinberger Foucaults Analyse treffend zusammen: „Zwar bestehen die Diskurse aus Zeichen; aber sie benutzen diese Zeichen für mehr als nur zur Bezeichnung der Sachen“ (Rheinberger 2001: 27). Vielmehr würden die Diskurse Zeichen benutzen, „um Ordnung zu stiften, um Grenzen des Sagbaren zu errichten und um Objekte des Wissens bzw. ‚epistemische Dinge’ hervorzubringen“ (ebd.).
Sprache schafft Wahrheit und Sprache konsolidiert Macht- und Ordnungsverhältnisse. Beispiele für diese Annahme sieht Foucault in der Geschichte der Psychologie, Biologie und Sexualforschung. Mit der diskursiven Herausbildung von binären Urteilen in Vernunft und Unvernunft, normal und anormal sowie legal und illegal, kritisiert Foucault den repressiven Umgang mit zeitgenössischen Phänomenen, auf die die Wissenschaft immer eine rational-legitimierte Antwort zu haben scheint (vgl. Foucault 2005: 127ff.).
Wissenskritik = Wissenschaftskritik?
„Die Sprache zu erkennen, heißt nicht mehr, sich der Erkenntnis selbst möglichst stark zu nähern, sondern lediglich, die Methoden im allgemeinen auf ein besonderes Gebiet der Objektivität anzuwenden.“
Foucault 1974: 361
Mit dieser radikalen Bewertung der geisteswissenschaftlichen Diskurse zeichnet Foucault ein Bild des Zweifels vom Wissenssystem. Sprache hat somit eine selbstreferentielle Dimension, sie ist das Ergebnis einer gesellschaftlichen Ordnung und vermag deswegen Macht zu erzeugen oder zu erhalten.
Aber reduziert sich seine Analyse vom Wissenssystem lediglich auf eine Ablehnung der Wissenschaft als sich selbst folgender Dogmatik und Reproduktion? Der Wissenschaftstheoretiker Michael Ruoff verneint diese Auffassung über Foucault: „Es wäre nun völlig falsch, aus dem Bruch ein universales Prinzip machen zu wollen.“ (Ruoff 2009: 87). Er ist der Ansicht, dass Foucault den Kontinuitätsbegriff nicht als zwangsläufig negativen Prozess gedeutet hat (ebd.).
Zwar bekenne Foucault, dass etablierte Wissensstrukturen restriktive Machtverhältnisse bedingen können ‑ sie aber nicht zwangsläufig erzeugen müssen. So schreibt Foucault in Überwachen und Strafen (1992):
„Macht ist nicht so sehr etwas, was jemand besitzt, sondern vielmehr etwas, was sich entfaltet; nicht so sehr das erworbene oder bewahrte Privileg einer herrschenden Klasse, sondern vielmehr die Gesamtwirkung ihrer strategischen Positionen […].“
Foucault 1992: 38
Viel wichtiger sei es, gültige Ordnungsstrukturen – wie das Geflecht von Wissenschaft und damit verbundene Methodik und Sprache – auf den Prüfstand zu stellen (vgl. Ruoff 2009: 126). Nur durch die historische Auseinandersetzung mit Diskursen und Diskontinuitäten, als „Determinanten“ (Foucault 2001: 841) der Geschichte des Wissens und der Humanwissenschaften, kann eine aktive Reflexivität von Machtstrukturen gefördert werden.
A priori und die ganz eigene Kritik
Was bedeutet diese „Diagnostik der Gegenwartsgesellschaft“ (Foucault 2005: 320) für den Umgang mit unserem Wissen? Mit Foucaults Ansatz eines seriellen Geschichtsverständnisses, kann eine Sensibilisierung des Wissensbegriffs gefördert werden – weg vom rationalistischen Impuls des Absoluten und Kausalen. Gerade durch den Fokus auf die Genese von Wissensstrukturen werden ebendiese Strukturen prozessual und nicht mehr starr. Sie werden beweglich und veränderbar, womit die Genealogie von historischen Brüchen gleichsam zur Kritik an Machtstrukturen wird.
Das eigene Bewusstsein soll daher für eine kritische Betrachtungsweise außerhalb der eigenen Ordnung – Wissen – gedacht werden; ein Vorschlag zur Reflexion des Dogmas der Vernunft, der gegen das verinnerlichte a priori zum Gedankenspiel einlädt.
Ob man Foucaults Geschichtsverständnis aufgreift oder die erkenntnistheoretische Tradition der Aufklärung als linearen Prozess erachtet – an den Leser seiner Texte stellt sich ein Appell: Hinterfrage die Selbstverständlichkeit des Wissens!
Quellen
Bacon, F. (1825): Meditationes Sacrae. In: Montagu, Basil (Hrsg.): The works of Francis Bacon, Lord Chancellor of England. Bd. 1. London: William Pickering. S. 203-220.
Foucault, M. (1974): Die Ordnung der Dinge ‑ Eine Archäologie der Humanwissenschaften. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Foucault, M. (1992): Überwachen und Strafen. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Foucault, M. (2001): Dits et Ecrits. Schriften 1954-1969, Bd. 1 GA. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Foucault, M. (2003): Dits et Ecrits. Schriften 1954-1969, Bd. 3 GA. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Foucault, M. (2005): Analytik der Macht. Daniel Defert; Francois Ewald (Hrsg.): Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Grössing, H./ Mühlenberger, K. (2012): Wissenschaft und Kultur an der Zeitwende, Renaissance-Humanismus, Naturwissenschaften und universitärer Alltag im 15. und 16. Jahrhundert. Reihe: Schriften des Archivs der Universität Wien, Bd. 15. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Rheinberger, H-J. (2001): Experimentalsysteme und epistemische Dinge. Eine Geschichte der Proteinsynthese im Reagenzglas. Göttingen: Wallstein Verlag.
Ruoff, M. (2009): Foucault-Lexikon. Entwicklung ‑ Kernbegriffe ‑ Zusammenhänge. Paderborn: Wilhelm Fink Verlag. 2. Auflage.
Sarasin, P. (2016): Michel Foucault zur Einführung. Hamburg: Junius Verlag. 6. Auflage.
Spinner, H. F. (1977): Begründung, Kritik und Rationalität – Zur philosophischen Grundlagenproblematik des Rechtfertigungsmodells der Erkenntnis und der kritizistischen Alternative. Reihe: Wissenschaftstheorie Wissenschaft und Philosophie, Bd. 12. Wiesbaden: Springer